Im Winter, wenn es draußen grau und matschig ist, fällt es mir schwer zu glauben, dass es irgendwann wieder schöner wird. Erst wenn die ersten Frühblüher ihre Köpfe aus dem Boden strecken, keimt in mir die Hoffnung auf den Frühling.
Für uns sind Frühblüher ein Stimmungsaufheller. Für unsere heimischen Insekten sind sie die erste und somit wichtigste Nahrungsquelle nach dem Winter.
In diesem Blogbeitrag erfährst du mehr über die zwei unterschiedlichen Gruppen von Frühblühern und findest eine Auswahl an insektenfreundlichen Frühblühern für deinen Naturgarten.
Eine bunte Gruppe aus Zwiebel- und Knollenpflanzen
Obwohl Frühblüher (Frühlingsgeophyten oder Geophyten) aus botanischer Sicht zu den Stauden gehören, teilt man sie auf Grund ihrer ausgeklügelten Überwinterungsstrategie in eine eigene Gruppe ein. Während die übrigen Stauden nämlich auch im Winter dicht unter der Erde sitzen, ziehen sich Frühblüher im Herbst tief in die Erde zurück.1 Dank ihres unterirdischen Speicherorgans, der Zwiebel bzw. Knolle, besitzen Geophyten die Fähigkeit, Stärke und Mineralstoffe über den Winter hinweg einzulagern und im zeitigen Frühjahr vor allen anderen Stauden „in Lebensenergie“ umzuwandeln.2

Gemäß ihres Aufbaus unterteilt man Frühblüher in Zwiebel- und Knollenpflanzen.
Zwiebelpflanzen bestehen aus einer Zwiebel mit einem Pflanzentrieb, der von fleischigen Hüllblättern ummantelt wird. Diese Blätter schützen und ernähren die eigentliche Zwiebel. Zwiebelpflanzen sind gut winterhart und blühen meist im zeitigen Frühjahr. Schneeglöckchen und Hyazinthen gehören zu den bekanntesten Vertretern der Zwiebelpflanzen.
Knollenpflanzen hingegen haben keine einzelnen Blätter, sondern bestehen aus einem Stück. Viele Knollenpflanzen blühen meist noch bis in den Sommer hinein oder erst im Herbst. Krokusse bilden hier eine Ausnahme. Sie blühen bereits im zeitigen Frühjahr und sind, anders als die meisten Knollenpflanzen, winterhart.
Die ersten Frühblüher im Jahr

Schneeglöckchen und Winterlinge sind die ersten Frühblüher an denen Insekten Nahrung finden. Bereits im Februar, wenn der Boden teilweise noch von Schnee bedeckt ist, kann man die zarten Pflanzen bereits entdecken. Kurz danach folgen Märzenbecher, Blausterne, Hyazinthen und die ersten Krokusse.
Insbesondere für die Versorgung bestäubender Insekten ist diese Gruppe von Frühblühern von enormer Bedeutung. Arten wie die Gehörnte Mauerbiene (Osmia cornuta) und die Dunkle Erdhummel (Bombus terrestris) fliegen bereits im Februar. Im März folgen dann weitere Arten von Hummeln, Sand- und Furchenbienen. 3
Die folgende Tabelle zeigt den Blühzeitraum der bekanntesten Frühblüher auf. Indem du unterschiedliche Arten kombinierst, schaffst du ein größeres Nahrungsangebot für Insekten im Frühling.
| Februar | März | April | Mai | |
| Schneeglöckchen | ||||
| Winterling | ||||
| Märzenbecher | ||||
| Buschwindröschen | ||||
| Frühlings-Krokuss | ||||
| Blaustern | ||||
| Traubenhyazinthe | ||||
| Narzisse | ||||
| Wald Veilchen | ||||
| Wiesen Schlüsselblume |
Insektenfreundliche Frühblüher
Nicht alle Frühblüher, die wir im Handel kaufen können, stellen eine verlässliche Nahrungsquelle für Insekten dar. Ob ein Frühblüher für Insekten attraktiv ist oder nicht, hängt von seinem Nahrungsangebot ab. Während die ursprünglichen Wildtulpen zu den Insektenlieblingen gehören, ist der Trachtwert klassischer Gartentulpen sehr gering. In dem Buch Schön wild! Attraktive Beete mit heimischen Wildstauden im Garten von B. Kleinod und F. Strickler, findest du eine tolle Auswahl an insektenfreundlichen Frühblühern.
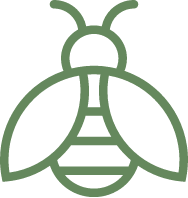
Wildformen sind insektenfreundlicher
Wenn du sicher gehen willst, dass die Frühblüher nicht nur schön, sondern auch nützlich sind, dann setze bei der Pflanzenwahl auf die Wildform.
Neben der eher klassischen Traubenhyazinthe, gehören meine liebsten Frühblüher zu den eher vegessenen Vertretern. Da man sie in konventionellen Pflanzenmärkten nur selten findet, kaufe ich sie gerne online (z.B. bei bingenheimer saatgut).
Hier eine kleine Auswahl meiner Frühjahrslieblinge:
Mit dem Stecken dieser Zwiebeln, holst du alte, teilweise gefährdete Pflanzen zurück in die Gärten und unterstützt aktiv unsere heimische Insektenwelt. So wird dein Garten mit der Zeit herrlich bunt und vielfältig.
Deine erdhummel.
(1) https://www.mein-schoener-garten.de/themen/blumenzwiebeln
(2) https://www.gartenflora.de/gartenwissen/ziergarten/zwiebelpflanzen-und-knollenpflanzen/zwiebelpflanze-knollenpflanze/
(3) https://bluehende-landschaft.de/blueten-fuer-insekten/


